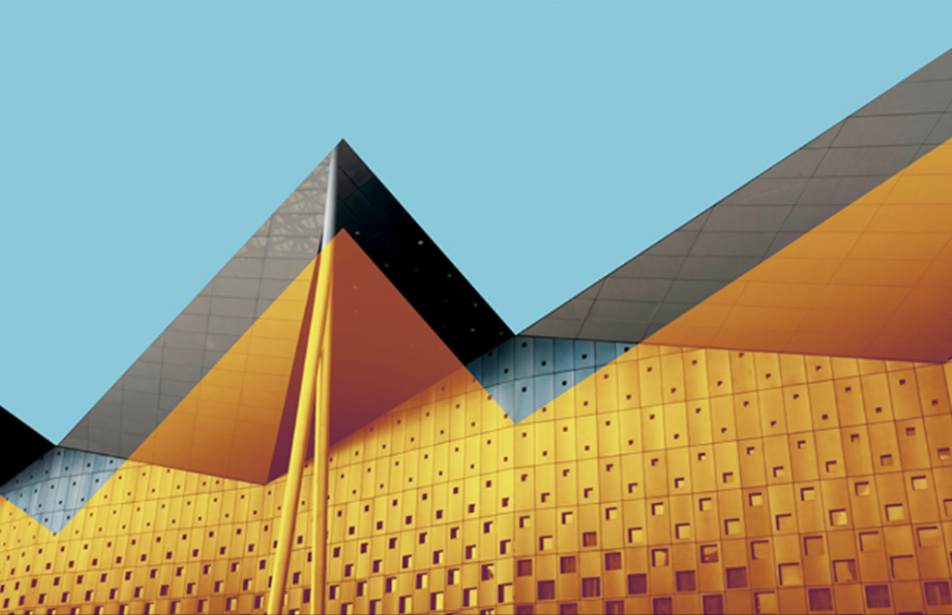Kolumne Dr. Bernhard Jünemann | Liebt Trump den Dollar?
Wie üblich feierte Präsident Donald Trump seine ersten 100 Tage mit einem Lob für seine Politik. Kein Vergleich war ihm zu billig, um seine „Großartigkeit“ zu verkünden. Wiederholt versprach er ein goldenes Zeitalter für die USA.
Doch die Finanzmärkte und die Umfragewerte für den Präsidenten sprechen eine andere Sprache. Seine drastische Zollpolitik, die er Anfang April verkündete, ließ die Börsen in die Knie gehen. Zwar hat Trump seine Pläne daraufhin etwas zurückgenommen, aber die Unsicherheit bleibt, dass er jederzeit den Handelskrieg wieder verschärfen könnte.
Das betrifft auch den US-Dollar, der bei weitem das wichtigste internationale Zahlungsmittel ist und als Hort der Sicherheit gilt, sozusagen der Leuchtturm amerikanischer Wirtschaftsstärke. Das brachte der amerikanische Finanzminister John Connally 1971 auf den Punkt: „Der Dollar ist unsere Währung, aber Euer Problem“. Damals strotzte Amerika vor Selbstsicherheit, obwohl der Greenback nach dem sogenannten Nixon-Schock unter Druck geraten war und die Garantie der Goldbindung aufgehoben werden musste.
Heute ist es der Trump-Schock, der den Dollar ins Rutschen brachte. Seit seinem Hoch im Februar kurz nach der Amtsübernahme durch Trump hat er rund zehn Prozent gegenüber dem Euro verloren. Die Frage stellt sich, ob Trump, der bekanntlich Zölle über alles liebt, auch den Dollar liebt. Natürlich preist er „our great currency“ über alles. Doch jetzt ist der schwache Greenback nicht nur die amerikanische Währung, sondern ein Problem für das Land. Denn der Präsident muss den riesigen Schuldenberg von 120 Prozent des Bruttoinlandprodukts finanzieren, der durch die geplanten Steuernachlässe noch weiter wachsen könnte. Dazu braucht er eine stabile Nachfrage nach amerikanischen Staatsanleihen.
Doch in den jüngsten Turbulenzen fielen nicht nur die Aktienkurse, sondern auch die Bondpreise, was die Schuldenfinanzierung deutlich teurer macht. Wenn man noch bedenkt, dass wohl ein Drittel der amerikanischen Staatsanleihen von chinesischen Adressen gehalten wird, kann man sich leicht ausmalen, wie ein Handelskrieg außer Zöllen negativ auf die amerikanische Währung wirken könnte, wenn die Chinesen US-Staatsanleihen massiv verkaufen.
Wenig vertrauenserweckend sind die kolportierten Pläne, amerikanische Staatsanleihen mit Laufzeiten von 100 Jahren zu versehen. Das kommt einer Enteignung von Gläubigern gleich. Wenig vertrauenserweckend auch die ständigen Aufforderungen an die Federal Reserve die Zinsen endlich weiter zu senken, obwohl die Zollpolitik die Inflation anheizen dürfte.
Die amerikanische Wirtschaftspolitik strotzt vor vielfältigen Dilemmata. Die Zölle sollen die Staatseinnahmen steigern und die Unternehmen veranlassen, mehr in den USA zu investieren. Aber sie erhöhen die Preise im Inland, heizen die Inflation an, bremsen das Wirtschaftswachstum. Ein schwacher Dollar soll ausländische Investitionen in die USA fördern und Exporte konkurrenzfähiger auf dem Weltmarkt machen, lässt jedoch die Kosten der Staatsfinanzierung explodieren.
Der schwache Dollar ist zum Problem für Amerika geworden.
Der schwache Dollar ist zum Problem für Amerika geworden, aber auch ein Problem für das Weltfinanzsystem. Denn trotz Fluchtbewegung, trotz Diversifizierung in andere Währungen, kann keine der anderen die Rolle des Dollars ersetzen, weder der Euro, der Schweizer Franken, der chinesische Renminbi oder der japanische Yen. Auch Gold und Kryptowährungen ohne staatliche Garantien schaffen das nicht.
Für Anlegerinnen und Anleger bleibt so nur, es den großen Adressen gleichzutun: mehr Diversifizierung und weg vom US-Dollar. Ihnen bieten europäische Aktien und Anleihen mehr Stabilität. Das Vertrauen in die USA ist beschädigt. Das wird sich nicht ändern, selbst wenn Donald Trump wieder mal seine Meinung ändert. Seine verbalen Dollar-Liebesbekundungen allein werden das Blatt nicht wenden.