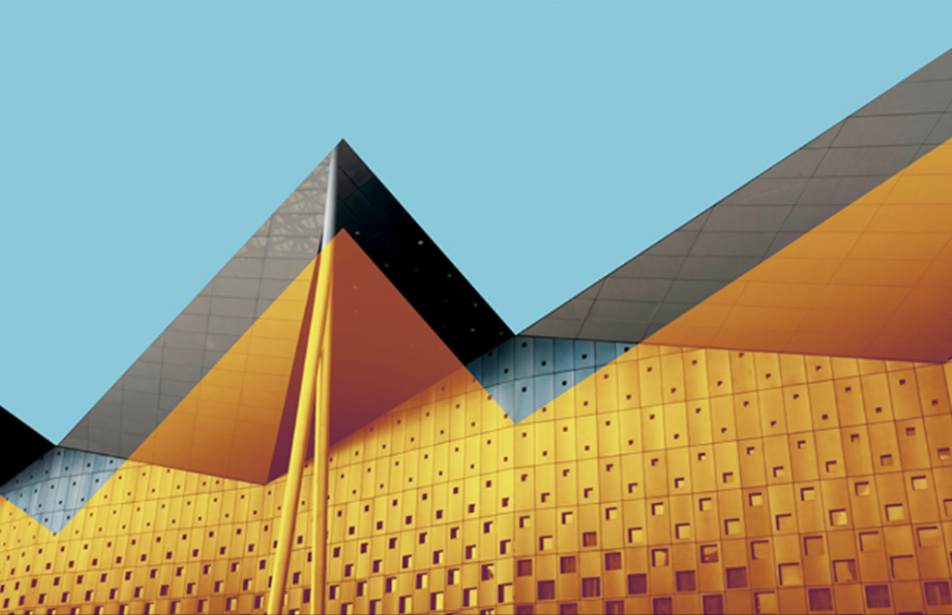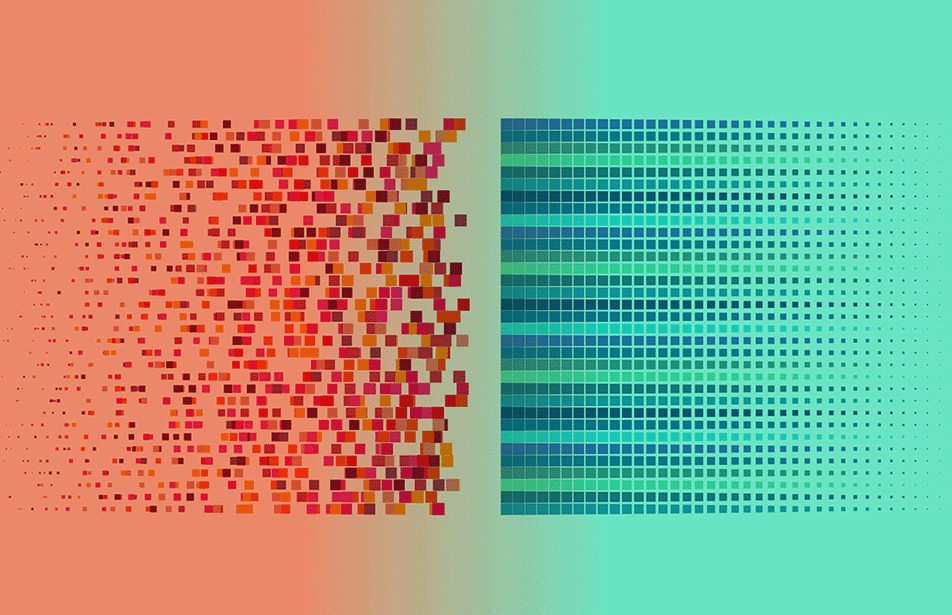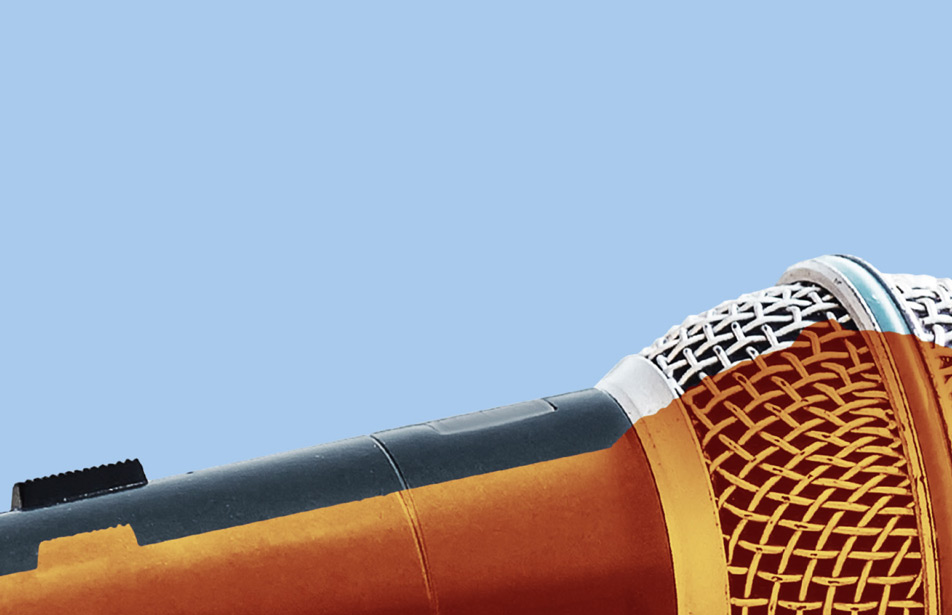Makro Research mit Dr. Ulrich Kater. | Notenbanken stehen am Ruder.
Eine Börsenweisheit lautet: „So wie die erste Handelswoche ist, so wird das Jahr.“ Selbst wenn an dieser Saisonregel statistisch gesehen nicht viel dran ist: In diesem Jahr könnte sie stimmen. Energiepreise, Lieferkettenschwierigkeiten, Inflation, der andauernde Krieg in der Ukraine: Derzeit scheinen diese Problemfelder die Konjunktur weniger zu belasten als gedacht. Die angekündigte Rezession fällt, wenn sie überhaupt eintritt, recht milde aus. Die zuletzt gemeldeten Konjunkturindikatoren überraschten überwiegend positiv. Die Arbeitsmärkte zeigen sich überaus robust. In den USA werden weiter Stellen aufgebaut, und dies bei nur begrenztem Lohndruck. Genau an diesem Punkt wird es spannend: An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die bisherigen Zinserhöhungen der Notenbanken ausreichen und dass mit den rückläufigen Inflationsraten schon bald wieder eine geldpolitische Lockerung auf dem Programm steht. Das ist der Hintergrund für die freundliche Kursentwicklung an den Märkten.
Ja, mittelfristig sieht es gut aus für die Aktienmärkte. Aber der Weg nach oben ist mit einigen Bodenwellen gepflastert. Aus Sicht der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank etwa wird an den Finanzmärkten schon zu früh darauf gewettet, dass der Hochpunkt der geldpolitischen Straffung überschritten ist. Wir haben den Äußerungen der Notenbanker dagegen entnommen, dass diese die Inflationsgefahren als zäher beurteilen, sodass uns erste zaghafte Leitzinssenkungen erst im kommenden Jahr realistisch erscheinen. Auch müssen die Unternehmen erst berichten, wie sie ihre Gewinne durch die Inflation und die schwächere Konjunktur beeinträchtigt sehen. Und nicht zuletzt können geopolitische Risiken schnell wieder zuschlagen.
Es gibt also trotz aller Erleichterung auch genug Potenzial für kurzfristige Ernüchterungen an den Märkten. Folglich könnten die Renditen noch einmal nach oben und die Aktienkurse nach unten korrigieren. Neben den Quartalsberichten der Unternehmen stehen die monatlichen Inflationsdaten und der geldpolitische Kurs der Notenbanken maßgeblich im Fokus.
Grundsätzlich ist das Umfeld für dieses Jahr jedoch konstruktiv, nicht nur für Aktien, sondern auch wieder für Anleihen. Die Risiken haben erst einmal an Bedeutung verloren. Und die neue Zinswelt lässt durchaus Raum für künftige Gewinnsteigerungen der Unternehmen und perspektivisch höhere Kurse an den Börsen. Zwar sind die Zinsen gestiegen, im historischen Vergleich bleiben sie jedoch immer noch relativ niedrig.
Konjunktur Industrieländer
Deutschland
Weiterhin überraschen die Konjunkturindikatoren positiv. Die bis November vorliegenden Konjunkturindikatoren zeichnen das Bild einer anhaltend widerstandsfähigen Wirtschaft. Die nach dem Kriegsausbruch stark gesunkenen nach vorne blickenden Umfrageindikatoren haben inzwischen wieder einen Aufwärtstrend ausgebildet. Hilfreich waren hierbei neben den staatlichen Unterstützungsmaßnahmen der bislang milde Winter und die Auflösung der Lieferengpässe. Die Folgen des Kriegs in der Ukraine zeigen sich bislang am deutlichsten in den energieintensiven Industriebranchen und in der Bauwirtschaft.
Prognoserevision: Bruttoinlandsprodukt 2023: -0,3 % (bisher: -0,7 %); Inflation 2023 bzw. 2024: 6,8 % bzw. 3,0 % (bisher: 7,2 % bzw. 2,9 %).
Euroland
Im Dezember wurden Details zum Wachstumsplus von 0,3 % im dritten Quartal 2023 veröffentlicht. Trotz der schlechten Stimmung bei den Unternehmen und den privaten Haushalten waren die Investitionen und der private Konsum die Wachstumsstützen. Das Wachstum wäre noch deutlich höher ausgefallen, wenn der Außenbeitrag nicht so gebremst hätte. Die Wirtschaft im Euroraum könnte damit im vergangenen Jahr um mehr als 3 % zugelegt haben. Die Inflation bleibt auch nach dem Rückgang auf 9,2 % im Dezember weit über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank. Selbst bei Herausrechnung des stärksten Inflationstreibers (Energiepreise) war die Preisentwicklung mit 7,2 % sehr stark. Die höchste Inflationsrate in der EWU hat derzeit Lettland mit 20,7 %, die niedrigste Preissteigerungsrate hat Spanien mit 5,6 % vorzuweisen.
Prognoserevision: Bruttoinlandsprodukt 2023: 0,3 % (bisher: 0,1 %); Inflation 2023 bzw. 2024: 6,4 % bzw. 2,8 % (bisher: 6,7 % bzw. 2,7 %).
USA.
Das inoffizielle monatliche Bruttoinlandsprodukt ist im November um 0,4 % erneut kräftig gegenüber dem Vormonat angestiegen. Insbesondere der Außenhandel trug zu diesem Anstieg bei. Zusammen mit den geringeren Energiekosten sowie einer bislang noch ordentlichen Beschäftigungsentwicklung hellt sich der Konjunkturausblick etwas auf. Wir gehen dennoch von einem baldigen Beginn einer Rezession aus, weil die deutlich restriktive Geldpolitik erst zeitverzögert ihre volle belastende Wirkung entfalten wird. Erste Signale sind bereits erkennbar: Die Stimmung der Unternehmen hat sich weiter verschlechtert, und die Details zum Arbeitsmarktbericht waren weniger von Stärke geprägt.
Prognoserevision: Bruttoinlandsprodukt 2023: +0,4 % (bisher: 0,3 %); Inflation 2023: 3,7 % (bisher: 4,5 %).
Märkte Industrieländer
Europäische Zentralbank / Geldmarkt
Auf ihrer Sitzung am 15. Dezember signalisierte die EZB einen immer noch großen Anpassungsbedarf für die Leitzinsen. Sie wollte dadurch zum einen die seinerzeit herrschenden Markterwartungen korrigieren, da diese nach Einschätzung der Notenbanker zu unangemessen günstigen Finanzierungsbedingungen führten. Zum anderen geht die EZB in ihren neuen makroökonomischen Projektionen von einem langsameren Rückgang der Inflation aus, was eine stärkere geldpolitische Reaktion rechtfertigt. Wir rechnen nun mit Leitzinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte im Februar und März, gefolgt von einem letzten Schritt von 25 Basispunkten im Mai. Der von der EZB beabsichtigte Bilanzabbau dürfte sich vorerst eher auf die Renten- als auf die Geldmärkte auswirken. Während Banken in großem Umfang Mittel aus den Langfristtendern TLTRO-III zurückzahlen, wird die EZB die Wertpapierbestände des APP zunächst nur langsam reduzieren. Die Überschussreserven bleiben damit noch für längere Zeit hoch genug, um die €STR- und EURIBOR-Sätze an den EZB-Einlagensatz zu koppeln.
Prognoserevision: Umfangreichere Leitzinserhöhungen.
Rentenmarkt Euroland.
Auf ihrer Ratssitzung am 15. Dezember stellte die EZB nicht nur weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht. Sie brachte auch ihr Missfallen an den seinerzeit rückläufigen Renditen in den längeren Laufzeitbereichen zum Ausdruck. Wir rechnen daher für die kommenden Monate mit etwas weiter steigenden Renditen von Bundesanleihen, da die EZB andernfalls erneut ihre Bereitschaft signalisieren dürfte, die Leitzinsen stärker anzuheben als derzeit von den Geldmarkt-Futures angezeigt wird. Auch die hartnäckig hohe Kerninflation und die nur moderate konjunkturelle Abkühlung sollten zu höheren Renditen am langen Ende beitragen, da sie bis auf Weiteres keine Senkung der Leitzinsen erwarten lassen. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass der Bilanzabbau der EZB eher langsam vonstattengehen und die Staatsanleihemärkte daher nur wenig belasten wird.
Prognoserevision: Etwas höhere Renditeniveaus in allen Laufzeitbereichen.
Devisenmarkt: EUR-USD.
Der EUR-USD-Wechselkurs ist Anfang Januar auf 1,07 USD je EUR und damit auf den höchsten Wert seit Juni 2022 gestiegen. Dabei wurde die Euro-Aufwertung sowohl von den Konjunkturindikatoren als auch von der Geldpolitik unterstützt: Für Euroland werden wieder steigende Stimmungsindikatoren und positiv überraschende harte Daten gemeldet. Zudem hat die EZB nach der Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte (Einlagensatz bei 2 %) im Dezember weitere größere Zinsschritte avisiert. Dies hat zu einem deutlichen Anstieg der kurzlaufenden Bundrenditen und somit zu einer Reduktion der Zinsdifferenz zu den USA geführt. Der Aufwertungstrend des Euro dürfte sich fortsetzen, allerdings eher moderat, da die Belastungen für die Wirtschaft in Euroland noch nicht vom Tisch sind.
Aktienmarkt Deutschland.
Getragen von einer überraschend guten wirtschaftlichen Entwicklung im vierten Quartal 2022, sowohl in Deutschland als auch global, ist der Aktienmarkt positiv in das neue Jahr gestartet. Hilfreich war dabei auch, dass die für den Dezember gemeldete Inflationsrate deutlich unter dem Vormonatswert lag. Allerdings dürften die Inflationsraten zu Jahresbeginn noch sehr hoch bleiben, und die konjunkturelle Aktivität wird sich in den kommenden Monaten abschwächen. Gleiches gilt für die ab Ende Januar zur Veröffentlichung anstehenden Unternehmenszahlen. Das wird an den Märkten für Verunsicherung sorgen, es muss mit temporären Kursrücksetzern gerechnet werden. Da allerdings weder mit einer globalen Rezession noch mit ausgeprägten Gewinnrückgängen der Unternehmen zu rechnen ist, und da die Inflationsraten im Jahresverlauf 2023 deutlich nachgeben werden, gilt es, eine mögliche Schwächephase für den Positionsaufbau zu nutzen.
Prognoserevision: Aufwärtsrevision der 3-, 6- und 12-Monatsprognosen.
Unternehmensanleihemarkt Euroland.
Unternehmensanleihen sind mit großem Optimismus ins neue Jahr gestartet und haben die kräftige Erholung seit vergangenem Herbst fortgesetzt. Auch der hawkishe Schrecken, den die Notenbanken EZB, Fed und Bank of Japan den Märkten in die Weihnachtsferien mitgegeben haben, konnte wieder ausgeglichen werden. Mit den jetzt anstehenden Geschäftsberichten muss sich allerdings zeigen, ob die Unternehmen die teilweise überraschend guten Ergebnisse aus dem dritten Quartal wiederholen konnten und noch wichtiger, ob sie ausreichend zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr starten. Für den weiteren Jahresverlauf befürchten wir, dass viele Unternehmens- und Analystenprognosen wieder etwas nach unten angepasst werden müssen und die Spreads vorübergehend ein Stück herauslaufen.
Emerging Markets
Märkte.
Weitere Anzeichen eines abnehmenden Preisdrucks für US-Konsumgüter haben zu Jahresbeginn die Rentenmärkte unterstützt. EM-Aktien profitierten vom Ende der strikten Null-Covid-Politik und der Erwartung weiterer Stützungsmaßnahmen für den chinesischen Immobiliensektor. Die meisten Schwellenländerwährungen konnten in einem Umfeld erhöhter Risikoneigung gegenüber US-Dollar und Euro zulegen. Trotz der verbesserten Aussichten für China bleibt das globale Wachstumsumfeld schwierig, weil die gesunkene Kaufkraft der Konsumenten und die erhöhten Finanzierungskosten in Europa, Nordamerika und Lateinamerika im ersten Halbjahr zu einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts führen dürften. Da sich zudem die Hoffnung auf eine schnelle Zinswende noch in diesem Jahr in den USA nach unserer Einschätzung nicht erfüllen wird, bleiben Aktien anfällig für Rückschläge. Das Umfeld für Schwellenländeranleihen betrachten wir als günstig, weil die Renditen auf hohem Niveau liegen und der globale Zinsanhebungszyklus auslaufen dürfte. Das Risiko einer tiefen Rezession erscheint zudem mittlerweile geringer als vor wenigen Monaten.
Szenarien
Basisszenario (Wahrscheinlichkeit: 70 %)
Deglobalisierung, Demografie und Dekarbonisierung halten perspektivisch den Inflationsdruck hoch und dämpfen das globale Wachstum.
Regimewechsel am Kapitalmarkt durch dauerhaft höhere Zinsen.
Notenbanken werden Leitzinsen erhöhen, bis Rückgang der Inflationsraten hinreichend weit vorangeschritten und mithin gesichert ist. Erste Leitzinssenkungen sind frühestens 2024 zu erwarten.
Weltwirtschaft findet nach der Schwächephase im Winterhalbjahr 2022 / 23 zurück auf den Wachstumspfad.
Wegen weiterhin zu hoher Inflation und wegen deutlich gestiegener Zinsen werden Geld- und Finanzpolitik bis auf Weiteres die Entwicklung von Wirtschaft und Kapitalmärkten nicht mehr so stützen können wie bisher.
Für Europa und die USA sind bis 2024 schwaches Wachstum und zu hohe Inflationsraten zu erwarten.
In China begrenzen anhaltende Probleme mit Corona-Infektionswellen, verstärkte staatliche Regulierung und Korrektur im Immobiliensektor das Wachstum.
Aktienmärkte bewegen sich zunächst seitwärts mit hohen Schwankungen. Mittelfristig profitieren sie von globalem Wachstum und dem Umbau der Wirtschaft mit Blick auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
Zinsen dürften tendenziell niedriger als Inflationsraten bleiben. Kaufkrafterhalt der Geldanlagen funktioniert am besten über breit gestreute Wertpapieranlagen, allerdings unter Inkaufnahme von Wertschwankungen.
Negativszenario (Wahrscheinlichkeit: 25 %)
Dramatische Eskalation des Russland-Ukraine-Kriegs mit Ausweitung auf weitere Länder. Infrastruktur-Sabotage als Mittel der unkonventionellen Kriegsführung. Anhaltende Ost-West-Konfrontation verringert positive Wachstumswirkungen der Globalisierung.
Zweitrundeneffekte bei der Inflation setzen Lohn-Preis-Spirale in Gang und führen zu anhaltend höheren Inflationsraten. Notenbanken sehen sich dadurch zu einer extrem restriktiven Geldpolitik gezwungen, die eine massive Rezession auslöst.
Stark gestiegene Staatsverschuldung löst in Verbindung mit den spürbar gestiegenen Zinsen regionale bzw. globale Schuldenkrisen aus mit dem Risiko einer umfassenden Finanzkrise bzw. in Euroland einem erneuten Infragestellen der Währungsunion.
Dauerhafte ausgeprägte Wachstumsschwäche in China.
Wirkung der Impfungen verpufft wegen resistenter Coronavirus-Mutationen. Langanhaltende globale Pandemie verursacht wiederkehrende großflächige Stillstände. Vertrauensverlust führt zu Abwärtsspirale an den Finanzmärkten.
Positivszenario (Wahrscheinlichkeit: 5 %)
Inflationsraten gehen innerhalb kürzester Zeit zurück und bleiben dann im Bereich der Notenbankziele. Notenbanken können Zinsen zügig auf neutrale Niveaus zurücknehmen.
Einfrieren des Russland-Ukraine-Konflikts führt zu zügiger Beruhigung von Wirtschaft und Finanzmärkten.
Kräftige Gewinnanstiege der Unternehmen führen zu deutlichen Aktienkursanstiegen und wirken als Triebfeder für die Investitionsdynamik.
Überraschend starke Wachstumsdynamik in den Emerging Markets mit Schubwirkung für globale Wirtschaft.